R_Biographien
24.09.1873 - 03.10.1953 in Detmold
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Henriette Ries, geb. Hamlet (25.07.1835 - 05.02.1935) und David Ries (17.04.1825 - 08.07.1910), Viehhändler |
| Geschwister: | Julie Ries (geb. 08.08.1863) Josef Louis Ries (geb. 25.07.1867) Sally Ries (geb. 1870) Emma Linz (31.03.1876 - 03.09.1963 in Detmold) |
| Wohnorte: | Heidenoldendorf Detmold, Sachsenstr. 4 |
Minna Ries wuchs mit vier Geschwistern in Heidenoldendorf auf und zog mit ihrer Familie nach Detmold in die Sachsenstraße 4. Über Minna Ries' Leben liegen nur wenige Informationen vor. So ist nicht dokumentiert, welchen Beruf sie ausübte. 1930 wurde ihr das elterliche Haus übertragen, in dem mehrere ihrer Anverwandten lebten. Nachdem sich ihre Schwester Emma Linz und deren Mann Julius dazu entschlossen hatten, ihren Wohnort Schlitz 1936 wegen antisemitischer Anfeindungen zu verlassen, zogen sie 1938 zunächst zu ihr in die Sachsenstraße 4. Dem Ehepaar verkaufte Minna Ries einen Teil des Grundstücks, auf dem die beiden ein kleines eigenes Wohnhaus errichteten. Beide Häuser wurden zu sogenannten Judenhäusern erklärt. Am 5. August 1943 fiel ihr Haus Sachsenstraße 4 fiel an das Deutsche Reich.
Minna Ries wurde zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Schwager am 28. Juli 1942 mit dem Transport XI/1-425 nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebte erkrankt und gezeichnet das Lager. Minna Ries kehrte am 28. November 1945 aus der Schweiz, wohin sie das Rote Kreuz von Theresienstadt gebracht hatte, zurück nach Detmold in die Sachsenstraße 4. Dort lebte sie nun mit Emma und Julius Linz, die ebenfalls Theresienstadt überlebt hatten und wieder nach Detmold zurück gekommen waren.
Nach Aussage von Minna Ries in dem von ihr angestrengten Rückerstattungsverfahren fanden sie das Haus in "abgewirtschaftetem Zustand" und leer geräumt ohne Möbel, Hausrat, Kleidung und weitere Einrichtungsgegenstände vor. Ihrem Antrag auf Rückerstattung wurde mit Beschluss vom 25. Februar 1950 stattgegeben. Sie lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 1953 zusammen mit ihrer nunmehr verwitweten Schwester Emma in der Sachsenstraße 4.
Sie hatte ihre Geschwister Julie, Josef, Sally und ihre Schwägerin Rahel im Völkermord verloren. Auch sie waren zunächst nach Theresienstadt deportiert worden und wurden von dort in das Vernichtungslager Treblinka verschleppt. Sie wurden umgehend nach ihrer Ankunft ermordet.
QUELLEN : StdA DT MK; LAV NRW OWL D 20B Nr. 3469; Arolsen Archives
zurück zur alphabetischen Namensliste zu den Verzeichnissen
- Details
geb. 03.12.1877 in Wunstorf - September 1942 im Vernichtungslager Treblinka
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Ehemann: | Josef Ries |
| Kinder: | Fritz Ries (verh. mit Margot Ries, geb. Rothschild) Hans Ries Käte Sass, geb. Ries |
| Wohnorte: | Hannover, Tiedgestr. 12 08.04.1941 Detmold, Sachsenstr. 4 28.07.1942 "nach Theresienstadt abgemeldet" |
Rahel Ries war seit dem 23. Februar 1896 mit Josef Ries verheiratet und zog 1941 mit ihm nach der Zerstörung dessen wirtschaftlichen Existenz durch den NS-Staat nach Detmold, wo sie in einem der sog. Judenhäuser leben mussten.
Das Ehepaar wurde am 28. Juli 1942 mit dem Transport Nr. XI/1 - 423 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Am 23. September 1942 wurden mit dem Transport Bq - 1235 von dort in das Vernichtungslager Treblinka verschleppt. Dieser Transport umfasste 2005 Menschen. 2004 wurden sofort nach ihrer Ankuft ermordet. Einer von ihnen überlebte.
Vom Amtsgericht Hannover wurde das Ehepaar 1947 für tot erklärt. Das amtliche Todesdatum wurde auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.
Die Schwägerinnen Minna Ries und Emma Linz sowie deren Ehemann Julius Linz überlebten Theresienstadt und gehörten zu den wenigen, die nach Detmold zurück kehrten.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 20 B Nr. 1466, D 23 Detmold Nr. 4881, D 103 Lippe Nr. 896, L 113 Nr. 849, P10 Nr. 47; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 896; Beit Theresienstadt
- Details
22.08.1870 in Heidenoldendorf bei Detmold - September 1942 im Vernichtungslager Treblinka
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Eltern: | Henriette Ries, geb. Hamlet aus Heiden (25.07.1835 - 05.02.1935) und David Ries aus Heidenoldendorf (17.04.1825 - 08.07.1910), Viehhändler |
| Geschwister: | Julie Ries (geb. 08.08.1863) Josef Louis Ries (geb. 25.07.1867) Minna Ries (24.09.1873 - 03.10.1953) Emma Linz, geb. Ries (31.03.1876 - 03.09.1963) |
| Beruf: | Viehhändler, Kaufmann |
| Wohnorte: | Heidenoldendorf Hagen, Elberfelder Str. 4 |
Sally Ries war ursprünglich Viehhändler, betrieb aber zusammen mit seiner Schwester Julie ein Geschäft für Porzellan und Haushaltswaren in Hagen. Er wurde am 29. Juli 1942 von Hagen über Dortmund mit dem Transport X/1 Nr. 663 nach Theresienstadt deportiert. Zwei Monate später, am 23. September 1942, wurde Sally Ries - wie seine Geschwister Julie und Josef - mit dem sog. Alterstransport Bq -1074 in das Vernichtungslager Treblinka deportiert. Manche der alten und schwachen Menschen dieses Transportes überlebten nicht einmal den Weg aus Theresienstadt zur nahe gelegenen Bahnstation, von der sie ins Vernichtungslager gebracht wurden. Dort wurden die Ankommenden direkt nach ihrer Ankunft ermordet. Von den 2005 Menschen dieses Transports überlebte einer.
Die beiden Schwestern Minna Ries und Emma Linz sowie deren Ehemann Julius Linz überlebten Theresienstadt und kehrten nach Detmold zurück.
QUELLEN: LAV NRW OWL P 2 Nr. 8; Beit Theresienstadt; StdA Hagen
Zur Deportation vom 23.09.1942 von Theresienstadt nach Treblinka s.: http://db.yadvashem.org/deportation/transportDetails.html?language=de&itemId=5091985
-
- Details
28.03.1890 in Leer/Ostfriesland - 04.03.1943 im Konzentrationslager Theresienstadt
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch/evangelisch |
| Eltern: | Jehudi (gen. Gottfried) Roseboom, Schächter und Friederike Roseboom, geb. Goldschmidt |
| Bruder: | Name unbek. |
| Wohnorte: | Bethel Heepen/Bielefeld, Petristr. 266 (Petristift, Bethel) Detmold: 30.10.1940 Hofstr. 8 im Diakonissenhaus 03.03.1942 Gartenstr. 6 28.07.1942 "nach Theresienstadt abgemeldet" |
Die Meldeunterlagen der Stadt vermerken unter der Rubrik "Religion: jüd. get. ev.", denn Familienangehörige mütterlicherseits waren zum evangelischen Glauben konvertiert. Nach dem Tod ihrer Eltern lebte sie bei ihrem Großvater Isidor. Als Vormund wurde ein Onkel väterlicherseits, Horst Roseboom, bestellt. Seit ihrem elften Lebensjahr war sie an Epilepsie erkrankt. Am 29. April 1903 kam sie aufgrund dessen nach Bethel in das Haus Bethsaida, wo sie als "leicht schwachsinnig" eingestuft wurde. Ihr psychische Verfassung wurde auch durch zahlreiche Operationen im Laufe ihres Lebens beeinträchtigt. Am 13. Februar 1925 wurde sie getauft, obwohl einige ihrer Angehörigen sich gegen ihre Abkehr vom Judentum gestellt hatten. Ende der 1920er Jahre verschlechterte sich ihr psychischer Zustand zusehends. Pläne, sie aus Kostengründen aus Bethel zu entlassen, da die Notwendigkeit eine Anstaltspflege angezweifelt wurde, oder in ein israelitisches Heim zu verlegen, scheiterten letztlich aufgrund einer ärztlichen Intervention. Pauline Rosebooms Verbleib in Bethel wurde auch durch ihren 1925 erfolgten Übertritt in die evangelische Kirche befördert. Durch die Vermittlung des Pfarrers Heinrich Kötter wurde sie 1940 in das Kranken- und Siechenhaus Petristift nach Heepen verlegt, was sie vor der Ermordung im Rahmen der sog. Euthanasie noch rettete, denn aus Bethel waren am 21. September 1940 acht Patienten jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Wunstorf bei Hannover verlegt worden. Von dort aus wurden sie in das ehemalige Zuchthaus Brandenburg überstellt, um in der dort von der Zentrale der "Aktion T4" eingerichteten Gaskammer getötet zu werden.
Am 17. September 1940 wurde Pauline Roseboom in das Diakonissenhaus Detmold verbracht, wodurch sie einer weiteren Verfolgungsmaßnahme entging, denn von dort sollte sie in die Jacoby'sche Anstalt in Bendorf-Sayn, Israelitische Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Gemütskranke verlegt werden, in der "jüdische Geisteskranke" konzentriert wurden. Auf diese Weise konnte sie ein weiteres Mal gerettet werden.
Im März 1942 wurde sie in das Detmolder jüdische Altersheim eingewiesen. Am 28. Juli 1942 wurde sie von dort mit dem Transport Nr. XI/1 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert, wo sie umkam. Laut Todesfallanzeige des dortigen Ätestenrates starb sie an einer Herzerkrankung.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, L 113 Nr. 849; Beit Theresienstadt; www.holocaust.cz
LITERATUR: Grell, Hubrich (2010), Müller (1992), Müller (2008)
- Details
geb. 16.06.1939 in Hamburg
| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |
| Mutter: | Inge-Julie Rosenbaum |
| Großeltern: | Frieda Rosenbaum, geb. Meyer und David Walter Rosenbaum (02.12.1880 in Horn - 05.03.1938 in der Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus, Lemgo-Brake) |
| Onkel: | Heinz Philipp Rosenbaum |
| Wohnorte: | Neu Isenburg Detmold: Gartenstr. 17 19.03.1942 Hornsche Str. 33 30.03.1942 "abgemeldet nach unbekannt" |
Über Dan Rosenbaum ist lediglich bekannt, dass er - vermutlich zusammen mit seiner Mutter - am 30. März 1942 nach Warschau deportiert wurde. Er gilt als verschollen.
QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D87 Nr. 15; StdA der Freien und Hansestadt Hamburg; Standesamt 3 Hamburg/Hamburg Mitte; ZA B 1/34 Nr. 795
LITERATUR: Minninger (1985), Müller (1992), Müller (2008)
- Details
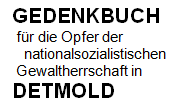


Thbn.jpg)
Thbn.png)
Thbn.png)
Thbn.png)
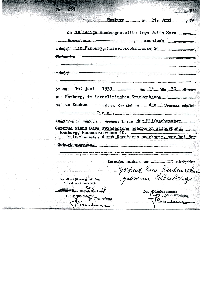
Thbn.png)